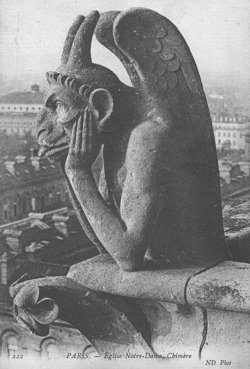Aachen. Kockerellstraße, auf dem Pflaster sitzt ein Mann, circa Siebzig, weißes Haar, Stoppeln im Gesicht, droht zur Seite zu kippen, mit dem Rücken angelehnt an den Pfeiler eines Schildes, vor ihm liegt ein alter Hut.
Nur wenige Schritte weiter Richtung Markt, unmittelbar vor Kaiser’s, ich werde angesprochen: „Haben Sie etwas Kleingeld für mich?“
Rathaus Ecke „Postwagen“, ein junger Mann, versucht mit drei Kegeln zu jonglieren, am Boden vor ihm seine Mütze, eindeutig.
Katschhof Höhe Hühnerdieb, eine Person, zusammengekauert, starr nach unten schauend, vor sich ein Pappschild mit der Aufschrift: Für eine Mahlzeit.
Zehn Meter weiter, eine Gestalt, mürrisch dreinschauend und freundlich grüßend, diesmal eine auffordernde Frittenschale mit ein paar Cent vor den Füßen.
St. Foillan, eine ältere Frau, oft sitzt sie dort bis in den Abend, Tag ein, Tag aus, bei jeder Witterung, die Botschaft ihrer Haltung ist unmissverständlich.
Dem „Kreislauf des Geldes“ gegenüber, wieder einer, der stumm um eine Kleinigkeit bittet, und so weiter.
Es gab sie schon immer, Bettlerinnen und Bettler, denen auch heuteoft unterstellt wird, sie seien zu faul um zu arbeiten, oder würden mit der vorgegaukelten Bitte um etwas zu essen nur ihren Alkoholkonsum oder andere Abhängigkeiten finanzieren. In dieses undifferenzierte Meinungsbild passt das mittägliche Gespräch dreier Rentner in einer Aachener Kantine, die darin übereinstimmten, Bettlern grundsätzlich keinen Cent zu geben, „da die ja sonst nie lernen würden, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen“.
Aber auch ein Student meinte, das Problem mit den Bettlern simpel lösen zu können: „Schließlich gäbe es ja genug Stellenanzeigen, in denen jemand zum Putzen gesucht würde!“ Scheinbar haben einige der Mittellosen Aachens sich freiwillig entschieden zu betteln, und die Anzahl derer nimmt zu. Denn an so mancher Straßenecke steht schon heute nicht mehr nur Einer, der um eine milde Gabe bittet, nein, ohne Probleme kann der spendierfreudige Aachener auf engstem Raum gleich zwei und mehr Anfragen bedienen.
Wie viele Bettlerinnen und Bettler verträgt eigentlich das Aachener Stadtbild? Alle müssen ja den Gürtel enger schnallen, Sozialleistungen werden gekürzt, direkte und indirekte Steuern steigen, die Arbeitslosenzahlen sind weiter im Aufwind, und die sozialen Probleme nehmen weiter zu. Es wird nicht ausbleiben, dass die Zahl derer noch weiter steigt, die aus unserem sozialen Netz herausfallen und als Problemfall Bettler auf unseren Straße landen.
Aber werden wir uns dann nicht eines Tages gezwungen sehen, ein Bettlerkontingent einzuführen, welches regelt, dass an jedem Wochentag nur 20 bettelnde Menschen in der Innenstadt angetroffen werden dürfen. Oder werden wir es der Bahn AG gleichtun, und Bettler auch aus der Innenstadt vertreiben! Aber wohin? In Gettos?
Vielleicht werden wir ja schon bald Rosen an die Bettler verteilen und so mit eher eigennütziger Intention den Lyriker Rainer Maria Rilke nachahmen, der einer römischen Bettlerin eine Rose schenkte, und die dann ihren angestammten Platz einige Tage nicht aufsuchte, weil sie, so der Lyriker, von der Rose lebte.
Noch ist es nur eine Frage: An wie viel Bettlerinnen und Bettler wird sich das Gemeinwohl, das gemeinsame Wohl von uns Aachenern wohl gewöhnen? Sie sind das äußere Symptom für eine Soziallandschaft, unter deren Oberfläche es gefährlich brodelt.
Quelle: Aachener Zeitung, 11.02.2003.