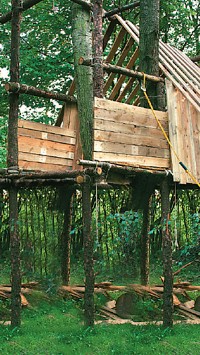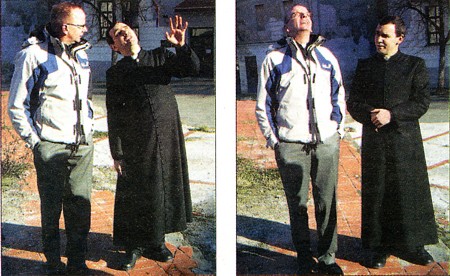Kar- und Ostertage mit Leidenschaft
Die Lust geht dem Fasten voraus.
Korrekt, werden u. a. nicht nur traditionellere Kreise in der Landschaft heutiger Theologie und spirituell eher spartanisch agierende Gruppierungen zustimmen. Denn genau sie, diese Lust (der Natur innewohnend) gilt es ja, dem überkommenen Verständnis der Fastenzeit gemäß zu bekämpfen.
Fastenziele
Ihr Ziel ist jedes Jahr neu das Alte: Die Veredelung der Seele und in Folge die des sittlichen Lebens. [1] Das kann auch anders lauten: Die Unterdrückung der leiblichen Begierde in all ihren Expansionen, die Züchtigung des Fleisches als der Kerkerzelle des Geistes oder die Entsorgung aller Ablenkung zur ballastfreien Hinwendung auf das Transzendente. Und, in Ergänzung: Das LThK von 2006 differenziert zum Stichwort „heutige Fastenpraxis“ das Fasten nochmals anders aus in seine medizinischen, sozialen und politischen sowie in spirituelle Aspekte. [2]
Darüber hinaus unterliegt die Intention der Fastenzeit oft auch zeitgeistigen Strömungen, Moden und Epochen, aber es gab und gibt auch immer wieder Autorinnen und Autoren, die den einen oder anderen Akzent neu oder anders die Fastenzeit betreffend hervor gehoben haben und es bis heute auch immer wieder tun.
So verstanden sind auch meine Ausführungen eine Akzentuierung:
Die Lust geht dem Fasten voraus! Nein, Sie können jetzt nicht einfach oben wieder anfangen den Artikel zu lesen. Denn, so mein Einwurf, die Lust ist in gewisser Weise nicht der. zu bekämpfende Feind in der Fastenzeit, sondern ihre zu hofierende Freundin.
Lust steht am Beginn der Fastenzeit
Was ist meine Motivation, oder allgemein gefragt, was leitet uns Menschen? Was lässt Sie, was lässt den Menschen grundlegend Veränderung wollen, warum bricht er aus den gebahnten Bahnen aus, warum mutet er seinem Körper und dessen Gewöhnung etwas Ungewohntes zu, wo nimmt die gewollte oder nur beeinflusste Veränderung ihren Anfang?
Leben ist nicht einfach nur ein unmotiviertes vor sich hin Stolpern, sondern den gesunden Menschen treibt etwas an sein Leben zu wollen: die Lebenslust. (Wenn die Lust Leben zu wollen z.B. durch Sinnverlust, Schicksal, oder Krankheit versiegt, dann kann das Lebenwollen in Gefahr sein.) Lust ist Antrieb, und sie geht allem (auch der intellektuellen Auseinandersetzung) voraus.
Wie ist Lust hier zu deuten? Wollen um des gewollten Wollens willen, das aus der Sinn- und Erlebensfülle geboren im Leib des Menschen aufsteht. Jedoch legitimiert sich Lust nicht einfach dadurch, dass es sie gibt ungeachtet ihres Endprodukts, dessen was bewirken oder hervorbringen kann. Lust ist der Grund überhaupt etwas erreichen zu wollen, und hier nicht der „Gegenstand“ selbst. (Der Mensch kann Lust erfahren wollen um der reinen Lust willen, ohne darüber hinaus gehende Ziele oder Erwartungen zu haben bzw. sie zu wollen.)
Erleben der Kar- und Ostertage
Leidenschaft ist (besonders in Abgrenzung zur Lust) ein Begriff, der eher in die Palette christlicher Grundbegriffe zu passen scheint. Ich meine jedoch, der Begriff Lust ist zwar selbstständig, aber der Leidenschaft sehr nahe. Allerdings gründet sie in „begrenzt erlebten Augenblicken“, während die Lust grundsätzlich und allgemein eine Seite des Lebenswillens ist.
Nach einem kleinen Sprung weitergedacht gehören so auch Lust und Leidenschaft zur Feier und zum Erleben der drei österlichen Tage vom Leiden, und Sterben, von der Grabesruhe und von der Auferstehung des Herrn, insofern diese Ereignisse mein Leben berühren können sollen oder existentieller formuliert: ich mich in der Lage weiß, sie mir „unter die Haut gehen lassen zu können“.
In der Feier des Abendmahles an Gründonnerstag gründet z.B. die Lust und Leidenschaft, Gemeinschaft gestalten zu wollen. In der Liturgie zum Karfreitag, in der die „Schläge zu hören sind, mit denen Christus ans Kreuz genagelt wurde“, gründet z.B. die Lust und Leidenschaft aufzustehen gegen Unterdrückung und Brutalität.
In der Feier der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus allerdings wird immer wieder neu der Ursprung und das Ziel aller Lust greifbar: Leben.
Passion mit Lust
Darf die Passions- und Osterzeit mit dem Begriff Lust so in Verbindung gebracht werden? Könnte man da nicht spirituell diplomatischer den Begriff Lust durch Engagement, Einsatz oder Bekenntnis ersetzen?
Nein, Lust ist eben mehr als nur akademisch intellektuelle Abwägung mit daraus resultierenden strategischen Handlungsfeldern. Lust schmeckt wesentlich auch nach Leib, Begeisterung, Kraftanstrengung, Einsatz, Schweiß und Haut (allen Sinnen) und ist nicht unvernünftig.
Lust, die Qualität des Lebens auch nach innen durch Wandel und Veränderung zu gestalten, ist aller Fastenzeit Anfang und Endspurt, soweit sie nicht nur Selbstzweck ist. Denn Fastenzeit ist Klärungszeit, die der Lust die Chance gibt anzustoßen, etwas zu bewegen und so zu verändern mit Mut zu allem was ich bin und habe. Fastenzeit und Kurskorrektur gehören zusammen – und da hat „die Lust zu wollen“ einen natürlichen Ort.
1 Herders Konversationslexikon, 3. Auflage, 1904, 441
2 Lexikon für Theologie und Kirche (LThK), 2006 Sonderausgabe, 1190 f.