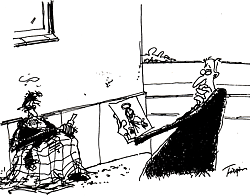 In der Fremde zwischen Jericho und Jerusalem fand vor über 2000 Jahren die Frage „Wer ist mein Nächster?“ eine zukunftsweisende Antwort. Diese Begebenheit um den „barmherzigen Samariter“ ist eine der vertrautesten Szenen der Heilige Schrift. Der Fremde aus Samárien, ein Barmherziger. Der Fremde am Straßenrand, ein Verletzter. Der fremde Priester und der fremde Levit‘ Dienstbeflissene. Der fremde Wirt, biblischer „Begründer“ des Caritas Pflegedienstes.
In der Fremde zwischen Jericho und Jerusalem fand vor über 2000 Jahren die Frage „Wer ist mein Nächster?“ eine zukunftsweisende Antwort. Diese Begebenheit um den „barmherzigen Samariter“ ist eine der vertrautesten Szenen der Heilige Schrift. Der Fremde aus Samárien, ein Barmherziger. Der Fremde am Straßenrand, ein Verletzter. Der fremde Priester und der fremde Levit‘ Dienstbeflissene. Der fremde Wirt, biblischer „Begründer“ des Caritas Pflegedienstes.
Die Geschichte von dem Fremden, die Jesus erzählte, bedarf nur ihres Anfangs, um vor unseren Augen die Straße nach Jerusalem entstehen zu lassen und auf ihr die uns so vertrauten Akteure. Besonders im Bühnenspiel der Kinder bekommt diese Szene tränenschwere Realität, und katechetisch aufbereitet lässt sie im Gottesdienst jeden erfahren, was er eigentlich schon immer wusste:
Christen sollen helfen. So weit, so gut.
Doch wer sich mit dieser Erkenntnis zufrieden gibt, läuft Gefahr, Lebensqualität zu verpassen. Denn es geht in diesem Bericht, den Jesus als selbst findbare Antwort auf die Frage nutzt, wer denn auch mir der Nächste sei, nicht nur ums Helfen. Jesus hebt in seiner befreienden Botschaft auch das Fremde, das Angst machen kann, dergestalt hervor, dass durch das Helfen die Fremdheit des anderen in den Hintergrund tritt. Im Vordergrund steht nun die Berührung. Sie beginnt mit Ersthilfe in Not, mündet aber in die anhaltende Sorge.
In dieser Fortführung der Jesuserzählung bahnt sich jedoch schon die weitere Dimension an, die über diese situationsorientierte Hilfe und Versorgung hinausgeht. Auch in der damaligen jüdischen und römischen Kultur, so ist anzunehmen, war es bestimmt nicht üblich, Menschen in Not grundsätzlich zu übersehen, da blieben brutal Verletzte nicht einfach am Straßenrand liegen!
Nehmen wir dieser Erzählung einmal ihren Spannungsbogen, und beschränken wir sie nur auf ihre vier Akteure, dann könnte die Erzählung, bezogen auf die Frage, wer denn mein Nächster sei, so lauten: „Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab; er sah ihn und ging weiter. Ein Levit sah ihn auch, aber ging vorbei. Dann kam ein Mann aus Samárien, ein Fremder, der auf Reisen war. Als er ihn sah, ging er auf ihn zu.“
Reduziert um die Spannung klingt diese Begebenheit langweilig. Keiner hätte sich solch eine Geschichte gemerkt, da sie nur auf die banale Tatsache zielt, dass tagtäglich Menschen einfach übersehen werden, egal ob bekannt oder fremd. Aber Jesus stellt auch den alltäglichen Menschen, jeder ein Unikat, in die Mitte gesellschaftlicher Beobachtung. Kranken, verletzten oder hilflosen Menschen zu helfen, ist eigentlich selbstverständlich.
Jesu Botschaft aber geht hinter diese möglichen Ausnahmen im Leben des Menschen zurück und fordert: Ihr Menschen in den Dörfern und Städten bedenkt, in jedem Menschen begegnet ihr dem verborgenen Antlitz Gottes. Dieses Antlitz Gottes im Menschen kommt auch aus der Fremde, ist oft fremd oder verhält sich fremd. Das Fremde macht auch manchmal Angst. Diese Angst jedoch kann nur durch die Nähe zum Fremden entmachtet werden. Gerade in der respektvollen Entdeckung der Menschen unseres Alltags, auch des Fremden, liegt das Mehr an Lebensqualität, das nach göttlicher Vielfalt schmeckt.
Wir können zwar heute die Sorge um die Menschen in Not an die Caritas, die Weithungerhilfe und das Rote Kreuz delegieren. Die bittere Erkenntnis eines Menschen, bezogen auf seinen Alltag, „Ich war gesund und ihr habt mich nicht wahrgenommen“, gilt nicht den Institutionen, sondern seinen Mitmenschen.