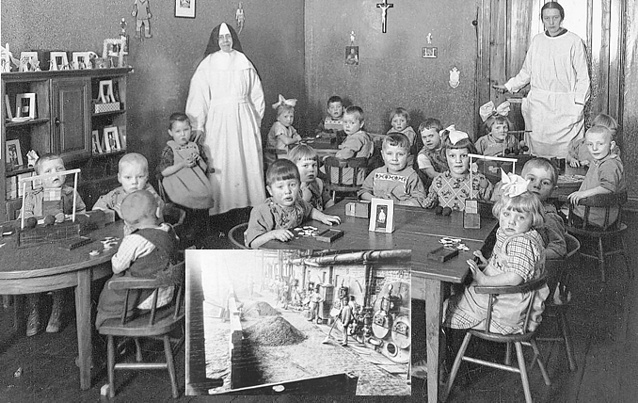Pastoral kreativer Umgang mit nicht mehr benötigtem Kirchengut
Mit dem Tag, an dem Jesus eine auch seinen Jüngern vertraute Kommunikationsform, nämlich die des gemeinsamen Mahls, im Abendmahlssaal (lat. Coenaculum) in Jerusalem in eine zwischen Gott und den Menschen bis dahin noch nie dagewesenen neue Kommunikationsform transformiert hatte, begann, wohl noch im Verborgenen, die christliche Geschichte vom Sakralgerät.[1]
Wo ist eigentlich …?
Mit der Geschichte vom Sakralgerät ist bis heute oft die Frage verbunden: „Wo ist eigentlich … geblieben?“ Denn die Geschichte des sakralen Gerätes beginnt als Verlustgeschichte. Wo ist eigentlich der Gral geblieben? Diese Frage bezieht sich, wissend um die unterschiedlichen (mythischen) Erzählstränge des „Gralsglaubens“, auf den christlichen (auch nicht in Reinkultur zu habenden) Erzählstrang, nach dem als Gral das Trinkgefäß verstanden wird, das Jesus beim Abendmahl in Händen gehalten hatte.
Erweiterte Fahndung nach sakralem Gerät
Doch nicht nur nach diesem speziellen Sakralgerät wird gefahndet. Problemlos ist die Fahndung auszuweiten mit der Frage: „Wo ist eigentlich all das Sakralgerät des späten Mittelalters geblieben oder das der Jugendstilepoche?“
Bis zum ersten Weltkrieg gab es in Städten wie Köln, Aachen, Münster, Berlin, Osnabrück oder Hildesheim fast an jeder zweiten Straßenecke eine Kirche oder ein Kloster mit Kapelle, von denen bis heute viele aufgelöst sind. Wo aber sind ihr Sakralgerät und ihre Kirchenausstattung geblieben? Nur ganz besondere Stücke der Ausstattung dieser Kirchen und Kapellen haben es in die Domschatzkammern, Museen oder deren Depots geschafft. So werden beispielsweise heute in der Domschatzkammer zu Aachen das Lotharkreuz (um 1000) gezeigt, in der Kölns ein gotischer Bischofsstab (um 1480/90), in der Essens die Goldene Madonna (um 980), in der Hildesheims der sogenannte Bernwardkelch (1365-1398) und in der Domschatzkammer Osnabrücks der Cordula-Schrein (1446/47).
Darüber hinaus lässt sich die Fahndung auch ausweiten auf Paramente wie z.B. Messgewänder, Stolen, Chormäntel oder Kelchvelen mit denen jeder Gottesdienstort unterschiedlich reich ausgestattet war.[2]
Generell darf bei der Frage nach dem Verbleib nicht übersehen werden, dass so manches Sakralhandwerk, aber auch Paramente in Kriegen zerstört wurden. So der „Zerstörte Kelch“ aus Aachen. Er wurde unter den Trümmern des 1875 errichteten neogotischen Hochaltars in der Chorhalle des Aachener Doms gefunden, der beim Bombenangriff am 24. Dezember 1943 völlig zerstört wurde. Übrig blieb (und als Ausnahme bis heute erhalten) ein rußgeschwärzter, zerdrückter schlichter Kelch aus vergoldetem Silber.[3]
Der Verbleib von Sakralhandwerk sowie Paramenten bleibt oft deshalb im Verborgenen, weil sie, wenn im Wandel der Moden als unmodern eingestuft, „eingeschmolzen“ bzw. „umgearbeitet“, oder aber unter der Hand in private Hand gegeben bzw. verschachert wurden.
Michael und das Ziborium
Aber auch auf eine ganz andere Weise kann das Sakralgerät seinen angestammten Ort verlasse, wie die Geschichte dieses Ziboriums erzählt. Der Junge, nennen wir ihn Michael, war ein engagierter Messdiener in den 1970iger Jahren in einer Stadt am Niederrhein mit rund 200.000 Einwohnern. Jeden Sonntagmorgen diente er in der Kapelle eines Altenheims. Als dieses vor dem Abriss stand, um einem Neubau ohne Kapelle Platz zu machen, sprach ihn die Krankenschwester, die die Sakristei mitversorgte, nach der letzten Messe an. Sie hielt ein leeres Ziborium, das sonst im Gottesdienst gebraucht wurde, in der Hand, reichte es dem Jungen verbunden mit der Bitte: „Nimm du es mit, hier ist dafür keine Verwendung mehr, und pass gut darauf auf.“ Das tat Michael und er tut es bis heute.
Die neue Frage: Wohin mit dem Sakralhandwerk?
Mit der Abnahme der gottesdienstlich aktiven Christen, der damit verbundenen einschneidenden Reduzierung von Gottesdiensten, auf die ein abzubauender Überschuss an Kirchenraum folgte, reduzierte und reduziert sich weiter das im „Dienst“ befindliche Kirchengerät. Auch die Auflösung von Klöstern setzt Sakralgerät und Paramente frei. Damit stellt sich die neue Frage im Kontext des Verbleibs von Sakralhandwerk: Wohin mit all der Hinterlassenschaft die nicht mehr gebraucht wird?
Wohin also mit den ausgedienten Gerätschaften der Liturgie wie Aquamanile, Kreuzen, Schellen, Kelchen, Patenen, Ziborien, Leuchter, Monstranzen, Pyxiden, Messkännchen, Taufkannen und Taufschalen, Weihrauchfässern, Schiffchen und den leeren Gefäßen für die Heiligen Öle? Wohin mit den ungetragen Paramenten in den Farben Weiß, Grün, Rot, Violett, Schwarz, Rosa und Blau? Wohin mit Tabernakeln, Heiligenfi guren, Leuchtern, Evangeliaren, Amben, Kreuzwegstationen, Fahnen, Baldachinen und Weihwasserbehältern? Spitz gefragt: Wohin mit der Hinterlassenschaft einer Volkskirche, die nicht einmal mehr für die herkömmlichen Museen und Domschatzkammern taugt.
Der „sakrale Ballast“ des liturgischen Gerätes
Theoretisch könnte (mobiles) Kirchengut entsorgt werden indem man es verkauft, auf Gemeinden in ärmeren Ländern und Kontinenten verteilt oder in Archiven „einmottet“ nach dem Motto: „aus den Augen aus dem Sinn“. Somit hätte man eine (kleine) Sorge weniger. Hinzu kommt, dass die Zeit vorbei ist, in der dem Sakralhandwerk ein uneingeschränkter Respekt zuerkannt wird. Dieser Respekt nährte sich von seiner liturgischen Nutzung, in der der Gegenstand mit dem „Heiligen“ in Berührung gekommen war, und so ein wenig dieser „Heiligkeit“ auf den Gegenstand übertragen wurde.
Aber lautet dann die einzige Antwort auf die neue Frage: „Bitte entsorgen!“? Ist das „Fallholz“ christlicher Tradition, ein „Skandalon“, in diesem Fall nicht das Ansinnen, der Hinterlassenschaften einer Volkskirche, also deren liturgischen Gerät außer Vollzug sowie deren indirekter sozialer Wirkung in der Vergangenheit, zukünftig die „Stimme“ zu nehmen? Das wäre vergleichbar mit dem Stuhl, auf der die alte runzlige Oma die letzen 25 Jahre ihres Lebens täglich gesessen hat, der noch am Tage ihres Todes zu Klump geschlagen wird.
Die Antwort auf die Frage „Wohin mit der Hinterlassenschaft …?“ liegt nicht, so denke ich, im „Weg damit!“, also Entsorgen, sondern im „Her damit!“, sprich Benutzen (nicht mit dem Verb gebrauchen zu verwechseln). Denn Hinterlassenschaft bedeutet nicht automatisch etwas hinter sich lassen zu müssen. Es geht hier ja nicht um hochkarätige museumsaffine Kunst, sondern um Gerätschaften, Gegenstände und Stoffe, die oft künstlerisch einfach daherkamen, aber auch so einem exponierten Anliegen gedient haben. Also sprechen wir hier nicht von Sakralmüll, den es zu entsorgen gilt, oder Material, das auf seine materiellen Wertstoffe hin recycelbar wäre.
Sakralgerät ist religiöse und kulturelle Hinterlassenschaft
Sakralem Handwerk können drei Bedeutungsebenen aktuell zugeordnet werden.
1. Sakrales Handwerk ist Kulturgut
Der Umgang mit dieser Hinterlassenschaft ist zwar primär eine Aufgabe der Kirche, aber nicht nur. Denn z.B. ein Kelch als Kultgerät ist nicht ausschließlich binnenkirchlich relevant, sondern als Gebrauchsgegenstand innerhalb einer Gesellschaft auch deren Kulturgut. Das gilt nicht nur
für die museal relevanten Stücke, die allgemein anerkannt den vier Grundaufgaben eines Museums zugeführt werden müsse, der Präsentation, dem Sammeln, Bewahren und Forschen.
Das gilt so sicherlich nicht für die „Nachtschattengewächse“ der Sakralkunst. Sie gehören eher auf die kleineren lokalen Bühnen. Doch auch auf denen sollten sie angemessen inszeniert werden.
2. Sakrales Handwerk als Erinnerungswert
Bezogen auf den Erinnerungswert darf nicht gering geschätzt werden, dass Kirchen und Sakralgerät wie auch Paramente identitätsstiftende Funktionen hatten und haben, auch wenn sie nicht für jeden Bewohner einer Stadt oder eines Dorfes z.B. in gleicher Weise relevant waren für die Lebensvollzüge bzw. eigene religiöse Praxis. Beispielsweise die Custodia (Repositorium) der Schwestern vom armen Kinde Jesus (PIJ) aus Aachen ist künstlerisch gestaltet aus über hundert Professringen[4]. Jede Ordensfrau erhält anlässlich ihrer Professeinen Ring. Mitunter tragen Schwestern über 60 und mehr Jahre diesen Ring, der nach ihrem Tod von ihrem Finger abgestreift wird. Diese Custodia, bestehend aus den Professringen der verstorbenen Schwestern, ist identitätsstiftend für diese Ordensfrauen, die sich im Glauben zusammengehörig fühlen, und jene, die daran Anteil haben.
Oder das Evangeliar der Kirche St. Donatus in Aachen-Brand ist identitätsstiftend, da dessen Buchdeckel aus von der Gemeinde gestifteten Schmuckstücken wie Ringen, Münzen, Perlenketten Armreifen Uhren künstlerisch gestaltet wurde.
3. Sakrales Handwerk als Anknüpfungspunkt der Weitergabe des Glaubens
Die Hinterlassenschaft einer abtretenden Volkskirche könnte auch Anknüpfungspunkte für die aktuelle Weitergabe des Glaubens sein. An sakralem Gerät wie auch an Paramenten lassen sich elementare Grundlagen des Glaubens und der Kirche sowie ihre Wurzel in die Vergangenheit, Geschichte und Tradition aufzeigen. Patene und Kelch z. B. vergegenwärtigen allgemeine Kommunikationsformen und deren Transformation.
Die Monstranz verdeutlicht das Verhältnis zwischen Christus und seiner Kirche. Das Weihrauchfass in Funktion erzählt von der verborgenen Anwesenheit Gottes. Mit den Kännchen für Wein und Wasser lässt sich symbolisch herantasten an die Grundlagen menschlicher Existenz. Das reich verzierte Evangeliar vergegenwärtigt das Spannungsfeld von Gottes Wort in Menschenwort. Paramente lassen die Bedeutung der Verhüllung im „Angesicht“ Gottes begreifen.
Sakrales Gerät und Paramente helfen, sichder Gleichzeitigkeit von Profanem und Sakralem anzunähern. Sakralgerät kann also auch außerhalb seiner ursprünglichen Funktion zum „Einsatz“ gebracht werden als Anknüpfungspunk der „Erzählgemeinschaft“, wie christlichen Gemeinden auch bezeichnet werden sollten.
Klöster in Auflösung und „Lokal Heroes“
Im Zusammenhang dieser drei Bedeutungsebenen dürfen die Ordensgemeinschaften und Klöster nicht unerwähnt bleiben. Absehbar werden auch sie sich weiter in ihrer Präsenz reduzieren. Das stellt auch sie vor die hier angesprochene neue Frage. So macht es Sinn, auch gemeinsam nach Antworten auf diese Frage zu suchen. Eventuell haben die Ordensgemeinschaften ja auch noch einen besonderen „Schatz“. Gemeint sind ihre Ordensgründer, insofern sie einen konkreten lokalen Bezug haben und so zu „Lokal Heroes“ aufsteigen könnten.
Das Projekt „Lokal Heroes“ ist am Lehrstuhlfür Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts am Department Katholische Theologie der Philosophischen Fakultät der Universität Passau entworfen worden. Hier geht es um die Möglichkeiten, mit Hilfe der Biographien lokaler und regionaler Persönlichkeiten Stadtgeschichte und Glaubensgeschichte greifbarer werden zu lassen.[5]
Die gebündelte Situation
Soweit wir unsere eigene Geschichte, die Geschichte der Menschheit rekonstruieren können, ist festzustellen, dass der Mensch sich immer schon nach dem Himmel ausgestreckt hat, das Transzendente suchte und bemüht war, die Kommunikation mit dem Göttlichen zu ermöglichen. Die ungleiche „Begegnung“ zwischen dem Menschen und dem Göttlichen fand ihren Ausdruck darin, dass der Mensch seinerseits „Materialien“ in die Hand nehmen musste, um mit dem Immateriellen, dem Unstofflichen, Unkörperlichen bzw. Geistigen in Kommunikation zu treten. Dabei wurde den materiellen „Kommunikationsgegenständen“ durch den Kult, also der Kommunikation mit dem „Göttlichen“, eine besondere, eine herausragende Bedeutung zuteil. Sie wurden zum Kultgerät, zu „heiligen“ Gegenständen, zum Sakralgegenstand.
Um solchen Sakralgegenstand geht es auch hier, da gefragt wird: „Wo ist eigentlich …?“ So gefragt geht es erst einmal um herausragendes Sakralhandwerk wie den Tassilokelch, der in besonderer Weise Erbe der Menschheit ist und deshalb nachhaltig bewahrt werden muss. Mit dieser Frage ist aber auch der Verlust angesprochen der empfunden wird, wenn kostbares Sakralhandwerk verschollen ist. Das Verlustempfinden rührt einerseits daher, ein künstlerisch wertvolles Objekt verloren zu haben und andererseits daher, einen Gegenstand verloren zu haben, mit dem Menschen in die Welt des Göttlichen eingetaucht sind. Die jüngste Kirchengeschichte stellt uns das Sakralgerät betreffend vor eine neue Frage: Wohin mit dem „Alltagssakralgerät“, das nur „einfach“ gearbeitet ist und nicht mehr gebraucht wird?
Sakralgerät und Kirchengut erzählen Geschichten
Egal wie Sakralgerät bzw. Kirchengut gestaltet ist, es erzählt Geschichten. Diese entstehen aufgrund der „Machart“ und der Geschichten ihrer Materialien, der Funktion sowie dem aktuellen Verbleib der Sakralgeräte. Die „Machart“ erzählt Besonderes, wenn bestimmte Materialien benutzt wurden wie z.B. das Stück Kohle als Fuß eines Kelches, die oben erwähnte, aus Professringen gearbeitete Custodia oder das Messgewand, das früher einmal ein Fallschirm war. Die „Machart“ hat auch dann etwas zu erzählen, wenn ein Freundeskreis eine Patene mit Hilfe eines Goldschmiedes selber gearbeitet hat oder der Knauf des Deckels eines Ziboriums früher einmal ein Türknauf war.
Die Funktion z.B. einer Hostienschale erzählt davon, dass alle aus einem „Topf“ essen, das gemeinsame Mahl untereinander verbindet und dass jeder am Tisch des Mahles willkommen ist. Der aktuelle Verbleib spricht für sich. Stellen Sie sich einmal vor, ein ganz einfacher Chormantel hängt an der Garderobe einer vierköpfigen Familie! Allerding müssen die Geschichten von der „Machart“ und der Geschichte der Materialen, sowie jene von der Funktion vergegenwärtigt werden im „Zusammenspiel“ mit dem bezeichneten Sakralgerät oder Kirchengut.
Sakralgerät anders in die Hand nehmen
Die Frage zu beantworten: „Wohin mit der überflüssigen Hinterlassenschaft?“ bedarf kreativer Ansätze, und es müssen neue Perspektiven denkbar sein (dürfen). Wichtig ist auch, dass in den Gemeinden für die hier angedachten Perspektiven geworben wird und Interessierte ermutigt werden, die Ansätze im Folgenden lokal weiter zu denken. Wichtig ist, dass mit den Interessierten auch ihre verschiedenen Kompetenzen, Motivationen und Erfahrungen gewollt sind, auch wenn sie gegenläufig scheinen. Standesdünkel, Gewohnheiten, Überlieferungen, angestammte Rechte, Titel und persönliche Befindlichkeiten dienen der Zukunft der Hinterlassenschaft nicht.
Es kann auf diese Frage auch nicht nur eine Antwort geben, sondern immer nur individuelle. Ergo kann ich hier auch „nur“ Perspektiven aufzeigen. So werde ich hier auch nicht die Idee eines Museums für „Gemeindliches Sakralhandwerk“ konkreter ansprechen, oder die Idee einer Bischöflichen Akademie mit „sakraler Wunderkammer“. Viel kleinteiliger sind die Perspektiven zu denken, die hier greifen sollen. Allerdings setzen sie eines voraus, den Materialwert eines Sakralgegenstandes dem Bedeutungswert unterzuordnen und der (heiligen) Aura des Gerätes die alltägliche Profanität zumuten zu wollen.
Perspektivisch aufgestellt an Beispielen
1. Beispiel: Sakralgerät als befristete Patenschaft
Kelche oder Ziborien können in der Kommunionvorbereitung wie auch in der Vorbereitung auf die Firmung in die Familien der Aspiranten befristet für z.B. eine Woche „ausgeliehen“ werden. Ein Sakralgegenstand in den „eigenen vier Wänden“ ist nicht nur ein „Eyecatcher“, sondern er ermöglicht weitergehende Auseinandersetzungen.
2. Beispiel: Sakralgerät als „behütende Ausstellung“
Die Möglichkeit, Kirchengut auszustellen, kann man auch auf einer herunter gehängten Ebene (nicht klassisch museal) andenken. Familienkreisen, Gebetsgruppen, Liturgiekreisen, Messdienergruppen u. Ä. stellt die Gemeinde für eine befristete Zeit einen Raum zur Verfügung. Die Aufgabe der Gruppe ist es, sich aus dem zur Verfügung stehenden Kirchengerät einige Objekte auszusuchen, um sie dann intelligent und kommunikativ im Raum zu präsentieren. Die inhaltliche Ausrichtung der Präsentation können die identitätsstiftenden Merkmale der Gruppe selbst sein. Intelligent meint, dass nicht nur Gerät museal hingestellt wird, sondern der Besucher in „behüteter“ Umgebung sich selbst auf das Exponat hin verhalten kann. Beispiel: Eine Taufschale ist ausgestellt, und ein Besucher legt sein alte Taufkerze dazu, sein Taufkleid oder die Konversionsurkunde.
3. Beispiel: Sakralgerät ohne Berührungsangst
Monatlich nach den Gottesdiensten könnte Sakralgerät in Kirchen oder Pfarrheimen verbunden mit einer einfachen Bewirtung zur „Berührung“ einladen. Hier könnten Geschichten erzählt werden vom „Werdegang“ des Gerätes, von deren Stiftern, jenen, die es benutzt haben, ob es restauriert wurde und warum, eben von all dem, was mit dem Sakralgerät verbindbar ist.
4. Beispiel: Sakralgerät als Zeichen
Gemeindegremien könnten mit einem anvertrauten Kelch das Signal der Verbundenheit mit jenen auf den „Punkt“ bringen, die im häuslichen Bereich pflegen. Ihnen ein Kelch aus der Gemeinde gebracht soll vergegenwärtigen, dass die Gemeinde zur konkreten Unterstützung bereit steht und sie im Gebet mit den Pflegenden und ihren Kranken verbunden ist.
5. Beispiel: Sakralgerät auf „Urlaub“
Kerzenhalter, Kreuzwegtafeln, kleine Kniebänke … können für ein Jahr in die Pflege einer Familie aus der Gemeinde gehen bzw. von Verbänden, Gruppen oder Organisationen versorgt werden. Einfach so nur, aber mit der Verpflichtung auf die Leihgabe aufzupassen.
6. Beispiel: Sakralgerät in fremder Umgebung
Eine (leere) Monstranz auf einem Tisch in einer Wärmestube positionieren, in der Nichtsesshaften ein Frühstück angeboten wird. Wenn dann die Monstranz einen „Ansprechpartner mitbringt“, könnten lebhafte Gespräche bei Tisch entstehen.
7. Beispiel: Sakralgerät als Kommunikator
Ungenutztes Sakralgerät, von dem Gemeindemitglieder wissen, dass es nicht für den Tresor bestimmt ist, könnte zum Kommunikator werden. Gruppen können einen Kerzenleuchter z.B. zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, was Licht in ihr Leben bringen kann. Diese Gedanken können dann ausgetauscht werden im Rahmen eines Klosterbesuches mit Ordensleuten, die anhand eines Sakralgerät ihres Klosters ihrerseits von dem erzählen, was ihr Leben aufhellt.
Nebenbei ein Kollateralerfolg
Soweit Beispiele, die Sie ermutigen sollen, auch den eigenen unkonventionellen Gedanken zu trauen, und ihnen eine Chance zu geben. Ein Kollateralerfolg bei solcher Nutzung könnte sein, dass ein neues Ehrenamt entsteht, neue Verantwortungen erwachsen und innerhalb der in Sachen Sakralgerät Engagierten neue Gruppen entstehen. Das Letzte: Vielleicht bleibt ja so die Geschichte von Michael und dem Ziborium weiter aktuell.
Anmerkungen:
[1 ]Mit dem Begriff Sakralgerät gleichbedeutend sind im Weiteren (wenn nicht ausdrücklich hinzugefügt) Paramente sowie Gegenstände aus dem
Kirchenraum. Dies bezeichnen auch die Begriffe Kirchengut, Kirchengerät, Sakralhandwerk und Hinterlassenschaft.
[2] Der Frage: „Wo ist eigentlich … geblieben?“ geht auch die Ausstellung „Verlorene Schätze“ nach, die im Rahmen des Karlsjahres 2014 in der Aachener Domschatzkammer präsentiert wurde. Im Vorlauf dieser Ausstellung, kuratiert von Dr. Georg Minkenberg, wurde aus Aachen stammendem, aber in der Welt verstreutem Kirchengut nachgegangen, um es in dieser Ausstellung leihweise wieder zusammenzuführen.
Ausstellungskatalog: Minkenberg Georg, Sisi Ben Kayad (Hg). Verlorene Schätze, Ehemalige Schatzstücke aus dem Aachener Domschatz.
Schnell & Steiner, 2014.
[3] Stender, Christoph. Schatzansichten – Entfesselnde Wortschätze. Grenzecho Eupen, 2001. S. 80 (ISBN 90-5433-152-6).
[4 ] http://www.hemsteck.com/svakj/project/1003/
[5 ]Weitere Informationen: http://www.uni-passau.de/index.php?id=14556
Erschienen in: Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hildesheim, Köln, Osnabrück. J.P. Bachem Verlag GmbH. Mai 05/2015